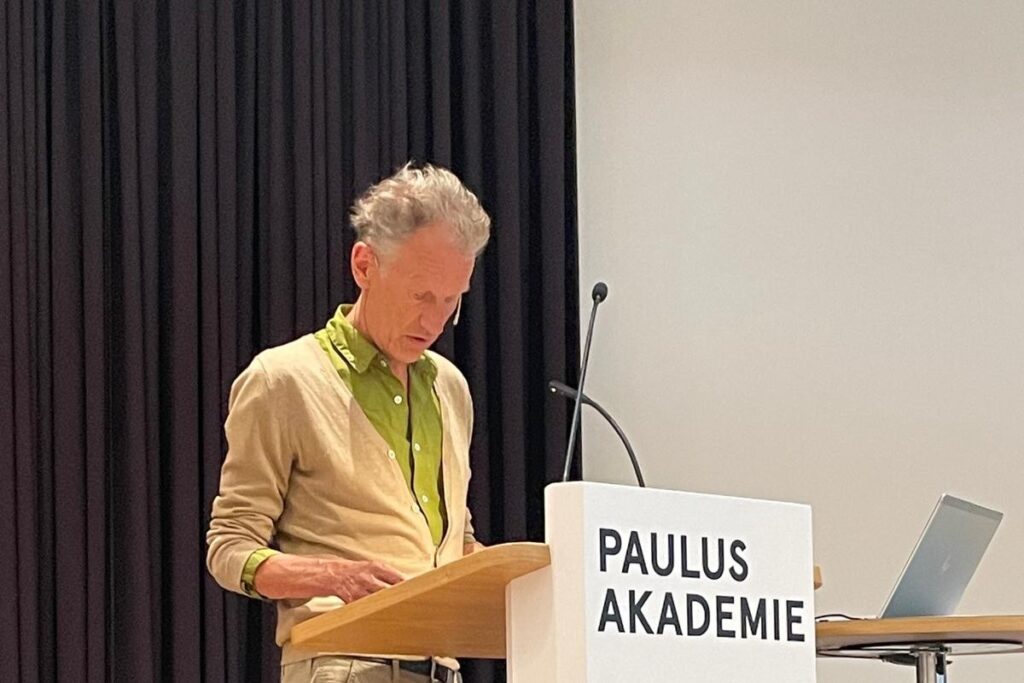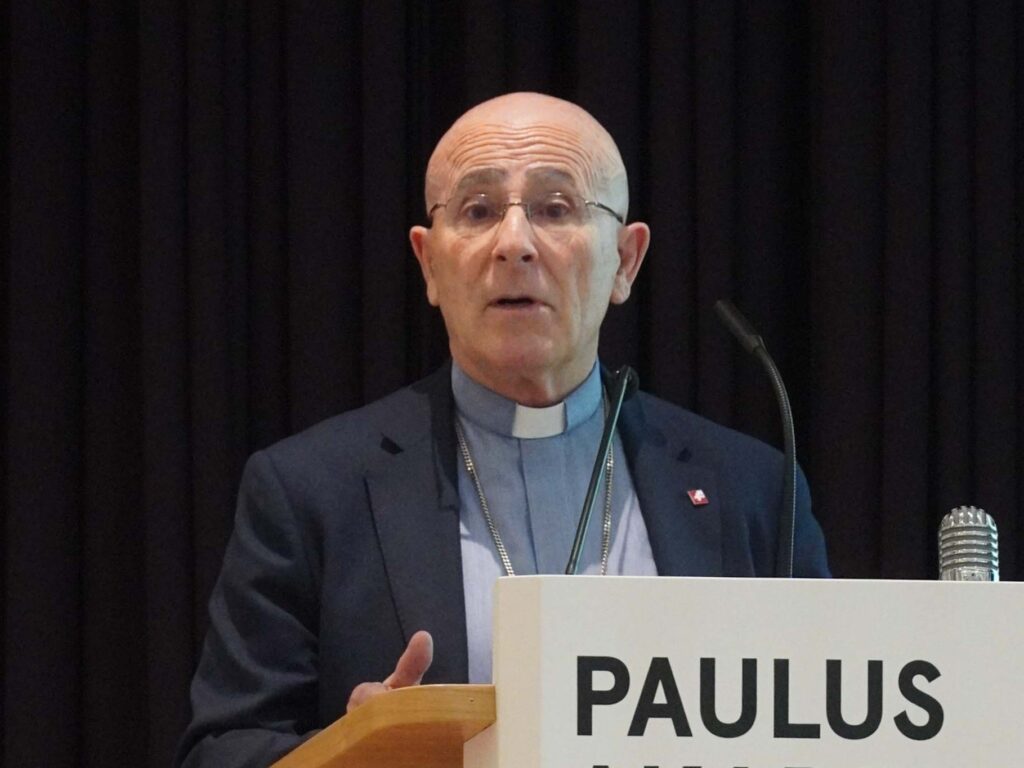Jahresbericht Studienjahr 2024/2025 – Ereignissplitter
Im Folgenden werfen wir einen Blick auf die Höhepunkte, die das akademische Jahr 2024/2025 inhaltlich und gemeinschaftlich bereichert haben.
Dies academicus 2025: Plädoyer für Rechtsstaatlichkeit
Zahlreiche Gäste aus Kirche, Gesellschaft und Politik kamen am Montag, den 21.10.2024 in der Aula der Theologischen Hochschule Chur zum Dies academicus 2024 der Theologischen Hochschule Chur. Zu Beginn begrüsste Rektorin Prof. Dr. Eva-Maria Faber die Anwesenden, besonders Bischof Dr. Joseph Maria Bonnemain und Peter Camenzind, den Generalvikar von Graubünden als Vertreter der Bistumsleitung. Aus der Politik nahmen Ständerat Stefan Engler und Dr. Gion Lechmann, Vorsteher des Amts für Höhere Bildung im Kantons Graubünden, an der akademischen Feier teil. Erfreulicherweise waren mehrere Vertretungen der staatskirchen rechtlichen Körperschaften, u.a. Mitglieder des Synodalrats der Katholischen Kirche im Kanton Zürich bei der Feier vertreten.
Die Festansprache zum Dies Academicus hielt Prof. Dr. Astrid Epiney, Professorin für Völkerrecht, Europarecht und schweizerisches öffentliches Recht an der Universität Fribourg, deren Rektorin sie 2015–2024 war. Unter dem Titel «Rechtsstaatlichkeit in Europa und in der Schweiz: rechtlich verbindlicher Grundsatz oder politische Leitlinie?» plädierte Epiney für den Schutz rechtsstaatlicher Prinzipien gegen verschiedene aktuelle Gefährdungen. Bei der Grundidee des Rechtsstaats gehe es um den
Schutz vor staatlicher Willkür über eine umfassende Bindung der Staatsgewalt an das Recht sowie die ‚absolute‘ Geltung bestimmter Mindestgarantien und die Beachtung geordneter Verfahren. Damit würde, so Epiney, letztlich politische Macht eingebunden und die elementaren Grundrechte der Einzelnen geschützt.
Epiney verstand ihre Überlegungen auch als Beitrag zur Versachlichung mancher Diskussion um staatliche Entscheid, die je nach Tagesaktualität immer auch von Emotionen geprägt sind. Über allen Kontroversen betonte sie das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit als ‚Leitplanke‘ für politische Diskussionen und wünschte sich, dass alle öffentlichen Institutionen künftig noch stärker Sorge um die Errungenschaften des modernen demokratischen Rechtsstaats tragen sollten.
Im Anschluss an die Festrede nahm Prof. Dr. Christian Cebulj die Preisverleihung des Churer Maturapreises für Religion 2024 vor. Lea Schumacher, frühere Schülerin der Kantonsschule Zürcher Oberland in Wetzikon, erhielt den ersten Preis für ihre Maturaarbeit zum Thema «Freikirchen und Sekten». Der zweite Preis ging an Anna Isler, die am Literargymnasium Rämibühl Zürich eine Arbeit über die spanischsprachige Mission im Kanton Zürich verfasst hatte. Mit dem dritten Preis wurde Lara Poltéra ausgezeichnet, die ihre Maturaarbeit an der Kantonsschule Am Burggraben St. Gallen eingereicht hatte. Die Arbeit trug den Titel «Jesus und die Frauen. Wie Jesus mit den Frauen um ging und welche Auswirkungen das auf Frauen im Urchristentum hatte». Die Maturapreise waren mit 500 Fr., 300 Fr. und 200 Fr. dotiert, Sponsorin war in diesem Jahr die Kath. Kirchgemeinde St. Anton Zürich-Hottingen.
Am Ende der Feier stand das Grusswort von Bischof Dr. Joseph Maria Bonnemain, dem Grosskanzler der TH Chur, der den Wert rechtstaatlicher Prinzipien auch nochmals unterstrich. Die Feier wurde musikalisch umrahmt vom Gesangstrio Clara Maria, Anna Catrina und Eva Luisa Scherrer, die von ihrem Vater Clau Scherrer am Piano begleitet wurden und für ihren wunderbaren Gesang den verdienten Applaus des Publikums erhielten. Im Anschluss an die akademische Feier wurden die Themen des Abends in geselliger Runde beim Apéro riche weiter diskutiert.
Christian Cebulj
Theologische Hochschule Chur veranstaltet Internationale Forschungstagung zum Thema Religion und Tourismus
Über 50 Personen aus fünf europäischen Ländern und zehn Schweizer Kantonen waren am 05./06.06.2025 der Einladung des Pastoralinstituts der TH Chur in die Paulus Akademie nach Zürich zu einer Internationalen Forschungstagung gefolgt. Gemeinsam mit dem Europäischen Netzwerk ‚Future for Religious Heritage‘ und dem Verein ‚Kirchen und Tourismus Schweiz‘ fragte die Tagung nach den Zusammenhängen von Religion und Tourismus. Neben den physisch anwesenden Teilnehmenden verfolgten ca. 70 Personen in ganz Europa die Tagung per Livestreaming.
Die Tagung, die im grossen Saal Korinth der Paulus Akademie begann, beeindruckte zunächst durch das höchst vielfältige Spektrum an Teilnehmenden. Einerseits waren internationale Expertinnen und Experten vertreten, die seit vielen Jahren zu den Schnittstellen von Religion und Tourismus forschen und mit ihren Vorträgen für die inhaltlichen Impulse der Tagung sorgten: Die Touristikerin Silvia Aulet (Universität Girona), der Architekt Andrea Longhi (Politecnico di Torino), der Tourismusforscher Harald Pechlaner (Universität Eichstätt) und der Theologe Harald Schwillus (Universität Halle-Wittenberg). Dazu kam die Religionssoziologin Uta Karstein (Universität Leipzig) und der Religionspädagoge Christian Cebulj (Theologische Hochschule Chur). Die Referate aus akademischer Perspektive wurde ergänzt durch Workshops, die Best-Practice-Situationen zum Thema hatten: Stefan Beier (Berlin) stellte den Verein Klosterland e.V. aus Deutschland vor, Elke Larcher (Stiftsbezirk St. Gallen) berichtete vom Projekt ‚Essen nach benediktinischer Art‘, Pfarrerin Monika Grieder analysierte Gespräche mit Touristinnen und Touristen im Zürcher Grossmünster und die Projektmanagerin Anastasiia Martakis (gutundgut GmbH, Lenzburg) präsentierte Formen des Placemarking anhand von Praxisprojekten.
Neben der Diskussion um Forschungsfragen geschah auch jede Menge Vernetzung auf der Tourismus-Tagung der TH Chur. Das bot sich an, denn es waren Vertretungen aus verschiedenen Institutionen, Vereinen und Initiativen an der Schnittstelle von Kirchen und Tourismus anwesend: Der Bruder-Klausen-Kaplan aus Sachseln war ebenso nach Zürich gereist wie die Erwachsenenbildungs-Beauftragte aus Luxemburg. Zwei Mönche vom Kloster Einsiedeln diskutierten mit einem Reiseveranstalter. Die Kirchenführerin aus Basel sass neben der Tourismusseelsorgerin aus Lausanne. Der Wanderleiter aus dem Thurgau traf auf die Museumsdirektorin vom Stiftsbezirk St. Gallen. Der Tourismuspfarrer der Evangelischen Kirche in Bayern unterhielt sich mit dem Vertreter des Vereins Jakobsweg Graubünden.
Besondere Akzente waren die Grussworte von Pilar Bahamonde (Präsidentin FRH, Cantabria/Spanien), Bischof Dr. Joseph Maria Bonnemain (Bistum Chur), Prof. Dr. Harald Schwillus (Universität Halle-Wittenberg) und Pfarrer Michael Landwehr (Präsident Verein KTCH). Von Seiten der TH Chur moderierten Prof. Christian Cebulj als Leiter des Forschungsprojekts „Religion-Kultur-Tourismus“ und Anna-Lena Jahn, Wiss. Mitarbeiterin beim Projekt die Tagung. Die Referent:innen und Workshop-Leitenden setzten spannende inhaltliche Akzente, die im Plenum angeregt diskutiert wurden. Teil des Programms war auch eine öffentliche Autoren-Lesung, bei der Prof. Dr. Valentin Groebner (Universität Luzern) aus seinem Buch „Ferienmüde. Als das Reisen nicht mehr geholfen hat“ ebenso amüsante wie nachdenkliche Passagen las.
Das Forschungsprojekt ‚Religion-Kultur-Tourismus‘ der Theologischen Hochschule Chur dankt allen akademischen Kolleg:innen für die Horizonterweiterung durch ihre Vorträge. Ein besonderer Dank geht an die Schweizerische Theologische Gesellschaft, welche die Veranstaltung als ihre Jahrestagung durchgeführt hat, an die Inländische Mission, die Kulturförderung des Kantons Graubünden und den Synodalrat der Kath. Kirche im Kanton Zürich für ihre finanzielle Unterstützung. Nicht zuletzt gilt der Dank der Tagungsleitung auch dem Direktor der Paulusakademie, Csongor Kozma, für die bewährte Gastfreundschaft in diesem wunderbaren Tagungshaus im Herzen von Zürich.
Alle Vorträge der Tagung wurden aufgezeichnet und können auf der Website der Forschungstagung nachgehört werden: https://thchur.ch/tagung-religion-kultur-tourismus/
Christian Cebulj
Gekürzte Fassung der Abschiedsvorlesung
Laudatio bei der Abschiedsvorlesung von Birgit Jeggle-Merz von Eva-Maria Faber und Margit Wasmaier-Sailer
Sie finden hier eine gekürzte Fassung der Abschiedsvorlesung.
Geschätzte Anwesende
Es ist mir eine grosse Freude, nach der Abschiedsvorlesung zusammen mit der Dekanin der Theologischen Fakultät Luzern Professorin Margit Wasmaier-Sailer einen Blick auf das Wirken von Birgit Jeggle-Merz zu werfen und ihr Engagement zu würdigen.
Birgit Jeggle-Merz ist mit Leib und Seele Liturgiewissenschaftlerin. Ihre Abschiedsvorlesung machte das erfahrbar und liess ihre Anliegen hervortreten. Was feiern Christen und Christinnen? Wie kann Liturgiewissenschaft dazu beitragen, die Dimensionen solchen Feiern zu erschliessen?
Die Liturgiewissenschaft kennt verschiedene Ausprägungen, eine mehr historische, eine mehr systematische oder eine mehr praktische Zugangsweise. Diese Ausprägungen lassen sich nicht auseinanderdividieren, und auch Birgit Jeggle-Merz hat diese Zugänge miteinander verbunden. Ihr Herz schlägt aber stark für die praxisbezogene und praxisnahe Aufgabe der Liturgiewissenschaft. Es ist ihr ein Anliegen, das konkrete liturgische Feiern zu beleuchten und zu erschliessen, es an der lex orandi zu messen sowie kritisch an ästhetischen Kriterien zu reflektieren, nicht zuletzt, um dadurch Orientierungen für die Gestaltung zu geben. Diese Fragestellungen brauchen historische Tiefe und systematische Reflexion, aber die Sinnrichtung gilt dem liturgischen Tun.
Für uns in Chur war das ein Glücksfall, und unsere Studierenden haben davon reichlich profitiert, auch für ihre spätere liturgische Praxis. Wir feiern hier einmal in der Woche Gottesdienst, und Birgit hat es häufig übernommen, die Studierenden bei der Vorbereitung der Feiern zu begleiten. Insbesondere in den Wort-Gottes-Feiern wurde erfahrbar, wie breit die mögliche Palette ist und wie es gelingen kann, eine Feieratmosphäre zu schaffen, die in die Gottesbegegnung führt.
Margit Wasmaier-Sailer: Schauen wir einmal zurück. Birgit Jeggle-Merz ist gebürtige Münsteranerin – ich meine, das Westfälische merkt man ihr deutlich an: Sie ist ehrlich und geradlinig. Man weiss, woran man bei ihr ist. Zugleich hat sie einen guten, bisweilen trockenen Humor, mit dem sie den Nagel immer wieder auf den Kopf trifft.
Birgit Jeggle-Merz hat es zum Studium der Katholischen Theologie dann zunächst nach Bonn und später nach Freiburg im Breisgau gezogen. Neben dem Diplom der Katholischen Theologie hat sie auch das Diplom in Caritaswissenschaften und Christlicher Sozialarbeit erworben. 1995 wurde sie an der Philosophisch-Theologischen Hochschule der Salesianer Don Boscos in Benediktbeuern bei Prof. Dr. Dr. h.c. Angelus Häussling im Fach Liturgiewissenschaft promoviert, was ihren weiteren Weg vorgezeichnet hat. 2001 bis 2006 war sie Akademische Rätin am Lehrstuhl für Dogmatik und Liturgiewissenschaft in Freiburg im Breisgau, 2006 wurde sie dann als Professorin für Liturgiewissenschaft nach Chur und zugleich nach Luzern berufen.
Sie war jetzt also 19 Jahre lang mindestens 28 Wochen mehr als vier Stunden mit dem Zug zwischen Chur und Luzern unterwegs. Unermüdlich, ja stoisch hat sie diese Kilometer quer durch die Schweiz immer wieder aufs Neue zurückgelegt. Das nimmt man nur auf sich, wenn man es aus Leidenschaft für eine Sache tut. Birgit Jeggle-Merz – es ist bei Dir, liebe Eva-Maria, schon angeklungen – ist mit Leidenschaft Liturgiewissenschaftlerin. Diese Leidenschaft ist auf die Studierenden sichtbar übergesprungen. Ich kenne unter den Kolleginnen und Kollegen kaum jemand, die oder der ähnlich viele Qualifikationsarbeiten betreut hat.
Eva-Maria Faber: Ja, liebe Margit, da stimme ich Dir vollkommen zu. Und es freut mich, dass diese zahlreichen Qualifikand:innen aus Vergangenheit und Gegenwart sehr zahlreich anwesend sind und nachher noch zu Wort kommen.
Birgit Jeggle-Merz hat aber nicht nur theologisch-liturgiewissenschaftlich gearbeitet. An der Theologischen Hochschule Chur hat sie die vielen administrativen Prozesse kraftvoll mitgetragen, insbesondere in ihrer langen Amtszeit als Studiendekanin. Ich komme darauf gleich noch zu sprechen. Ich habe ihr dann jeweils gegönnt, wenn sie montags sagte, dass sie am Folgetag nicht da ist, weil sie dienstags in Luzern präsent war. Ich war froh, dass sie sich in Luzern ein bisschen von den vielen Aufgaben hier erholen konnte.
Margit Wasmaier-Sailer: Erholen? Also in Luzern gab es dienstags immer zwei Lehrveranstaltungen, ausserdem bis in die Abendstunden hinein Fakultätsversammlung. Wenn nicht Fakultätsversammlung, dann Professorium. Ausserdem schon vor den Lehrveranstaltungen oder danach Fakultätsleitungssitzung, und in regelmässigen Abständen tagte dienstags auch noch die Lehr- und Prüfungskommission. Seit 2020 ist Birgit Jeggle-Merz Prodekanin der Fakultät und von daher mit allen strategischen Entscheidungen der Fakultät und gerade in Studienangelegenheiten auch mit deren Umsetzung befasst. Wenn ich darüber nachdenke, weiss ich gar nicht, wie so viele Veranstaltungen und Sitzungen überhaupt in einen Tag hineinpassen … Im Übrigen war Birgit Jeggle-Merz für uns auch immer gut erreichbar, wenn sie dann wieder in Chur war, so dass uns die geographische Distanz nur selten zu Bewusstsein kam. Eigentlich erst dann wieder, wenn sie ihren Koffer Dienstag frühmorgens durch die Gänge rollte.
Eva-Maria Faber: Ja, liebe Birgit, Du hast kein Aufhebens davon gemacht, dass Du an zwei Fakultäten Lasten getragen hast. Mir war klar, dass Du Dich in Luzern nicht erholst (vielleicht hast Du Dich von uns erholt, aber nicht von Arbeit). Von aussen lässt sich wohl kaum nachvollziehen, welche Energie Birgit Jeggle-Merz eingesetzt hat, um an zwei Fakultäten nicht nur zu lehren, sondern Mitglied des Professoriums und damit Mitträgerin der hochschulpolitischen und administrativen Prozesse zu sein.
In Chur hat Birgit Jeggle-Merz über viele viele Jahre das Studiendekanat geführt, von 2007 bis 2020, und als es dann nochmals akuten Bedarf gab aufgrund der Demission einer Kollegin, hat sie es nochmals von 2021 bis 2023 übernommen. Das ist viel Detailarbeit bei der Führung der Studierendendossiers, Anrechnungen usw. Weltkirchlich wurde an der zurückliegenden Synode darüber nachgedacht, ob ein Amt des Hörens eingeführt werden sollte. Liebe Birgit, Du hast ein solches Amt des Hörens als Studiendekanin schon ausgeübt, wenn Studierende kamen und z.B. mit Dir zusammen suchten, wie sie ihre Studienwege samt zusätzlichen Belastungen durch Beruf und Familie bewältigen sollen. Du hast intensiv zugehört, um diese Studienwege zu begleiten. Einer ganzen Generation von Studierenden hat das gutgetan, obwohl Du – gebunden an die Reglemente – keineswegs alle Wünsche erfüllen konntest.
Als Liturgiewissenschaftlerin war Birgit Jeggle-Merz permanent Teil des Leitungsteams für das Pastoralinstitut und zeitweise dessen geschäftsführende Leiterin. In diesem Rahmen setzte sie sich unter anderem für die Kooperation mit dem Kirchenmusikverband ein und war verantwortlich für die Kooperation mit der Universität Zürich im Blick auf einen CAS-Studiengang.
Margit Wasmaier-Sailer: Eva-Maria Faber und ich danken Dir sehr herzlich für die Weise, wie Du das Experiment der Doppelprofessur gelebt hast.
Die beiden Fakultäten haben diese Doppelprofessur im Jahr 2006 eingerichtet und es nicht bereut. Das liegt auch daran, dass Birgit Jeggle-Merz mit grösstem Engagement sich auf beide Fakultäten eingelassen hat.
Eva-Maria Faber: Insofern bedauern wir es auch, dass sich das Modell aus verschiedenen Gründen – und gerade angesichts der grossen Belastung – nicht fortführen lässt.
Margit Wasmaier-Sailer: Meinst Du, liebe Eva-Maria, Birgit Jeggle-Merz ist für sich auch auf ihre Kosten gekommen? Ich mache mir da ein wenig Sorgen … Bei den Budgetplanungen hat sie einmal gesagt, dass sie sich nicht einmal einen Bleistift auf Kosten der Fakultät gekauft hat. So sehr sie ihr Kostenbewusstsein ehrt, wie können wir das nur wiedergutmachen?
Eva-Maria Faber: Liebe Birgit, gut, dass ich das mit dem Bleistift erfahre. Da kann ich abhelfen, ich habe hier einen ganz ganz schönen, den ich Dir gleich gern überreiche. Aber ja, manchmal konnten wir uns schon auch Sorgen machen. Z.B. gab es da einmal einen Wutanfall bei uns im Lift, der sogar gefilmt wurde. Es war geplant, eine Serie Werbefilme zu drehen für das Theologiestudium. Dabei wollten zwei Mitarbeiter Dir nur ganz harmlos eine Frage stellen, eine, die uns sehr naheliegt. Sie gaben Dir an der untersten Liftstation die Frage mit: Was ist Theologie? – 30 Sekunden braucht der Lift bis in den 7. Stock. 25 Sekunden davon verbrauchte Birgit mit Schimpfen über die Zumutung dieser Aufgabe. Ihr reichten die 5 Sekunden am Schluss für eine Antwort, die es auf den Punkt bringt: «Was ist Theologie? Das schönste Studium überhaupt.» Der Clip ging im Instagramkanal der TH Chur viral.
Liebe Birgit, Du hast in den vergangenen Wochen häufiger zum Ausdruck gebracht, wie seltsam es sich anfühlt, dass nun auf einmal das, was früher weit in der Zukunft lag – die Emeritierung – tatsächlich vor der Tür steht. In einem irdischen Sinn ist für Dich das Künftige Gegenwart geworden.
Margit Wasmaier-Sailer: Wir wünschen Dir von Herzen, dass Du bald die Entlastung spürst, die mit der Emeritierung verbunden ist, und Zeit für das hast, was manchmal zu kurz kam: die Familie, Freizeit, und vielleicht auch manches Liturgiewissenschaftliche, das mehr Musse braucht, als es der akademische Alltag erlaubt.
Würdigung von Birgit Jeggle-Merz anlässlich ihrer Abschiedsvorlesung von Martin Klöckener
Sehr geehrte Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Liebe Familien Jeggle und Merz! Vor allem aber: liebe Birgit!
Es ist mir eine besondere Freude, dass ich heute Abend anlässlich Deiner Abschiedsvorlesung hier an der Theologischen Hochschule Chur eine kurze Würdigung als Freund und Kollege aus der Liturgiewissenschaft sowie als Gruß von der Universität Fribourg halten darf. Vor ungefähr 40 Jahren lernten wir uns in einer kleinen Gruppe junger Liturgiewissenschaftler und -wissenschaftlerinnen kennen, die der bekannte Benediktiner Angelus Häußling aus der Abtei Maria Laach, seinerzeit Professor für Liturgiewissenschaft und Sakramententheologie an der Hochschule der Salesianer Don Boscos im oberbayerischen Benediktbeuern, zusammengebracht hatte, weil er sich von diesen jungen Leuten auf Zukunft hin wichtige Impulse für die Liturgiewissenschaft und vor allem für das damals von ihm herausgegebene „Archiv für Liturgiewissenschaft“ erhoffte. Zunächst war dort Michael, Dein späterer Ehemann, auch ein promovierter Liturgiewissenschaftler, beteiligt, aber dieser brachte eines Tages zu unseren jeweils viertägigen Treffen eine junge Frau mit, die hervorragend in den Kreis passte. Deine Dissertation unter Leitung von Pater Angelus war gleichsam eine logische Konsequenz dieser jahrelangen wissenschaftlich fruchtbaren, äußerst nachhaltigen und freundschaftlichen Zusammenarbeit.
Vor etwas mehr als 20 Jahren spazierten wir beide am Rande einer Tagung in Trier an der Mosel entlang und besprachen intensiv die Situation der Theologie in der Schweiz, wo ich seit 1994 in Fribourg tätig war, erörterten die liturgischen Herausforderungen in diesem Land und manche anderen Aspekte, denn für Dich stand die Frage eines Wechsels von Deiner Stelle als Akademische Rätin an der Universität Freiburg/Breisgau auf die Doppelprofessur in Chur und Luzern an, die Du im Sommer 2006 antratst.
Vor knapp 10 Jahren hast Du an der Universität Fribourg aus gegebenem Anlass mein wissenschaftliches Wirken vorgestellt. Heute ist es auf Einladung Eurer Rektorin an mir, Dich und Dein wissenschaftliches Arbeiten zu würdigen. Was dann in 10 oder 20 Jahren sein wird, liegt nicht in unserer Hand.
Beginnen möchte ich mit meinem liturgischen Assistenzdienst im weiteren Sinne für Dich, für Euch, den ich bei Eurer Hochzeit 1986 in der frühromanischen Kirche St. Michael in Niederrotweil im Kaiserstuhl geleistet habe. Wenn zwei Liturgiewissenschaftler heiraten, ist das ja keine gewöhnliche Hochzeit. Ich will hier nicht auf die bestens durchdachten liturgischen Besonderheiten der Trauung eingehen, sondern auf zwei Probleme zurückkommen. Das erste Problem zeigte sich kurz vor der Trauungsmesse, als der Vorsteher, der schon erwähnte Angelus Häußling, bemerkte, dass er sein Predigtmanuskript in seiner Unterkunft vergessen hatte. So wurde ich beauftragt, so schnell wie möglich die Zettel mit der Predigt herbeizuschaffen, was trotz permanenten Überschreitens der erlaubten Höchstgeschwindigkeit auf den kleinen Straßen durch den Kaiserstuhl doch rund 45 Minuten dauerte; die Hochzeit begann deshalb mit einiger Verspätung, ohne dass in der Zwischenzeit jemand vom Schauplatz geflüchtet wäre. Das zweite „Problem“ eröffnete sich beim Betreten der Kirche: Wegen ihrer denkmalgeschützten Ausstattung, besonders eines kunstgeschichtlich wertvollen Schnitzaltars vorn im Chorraum, fehlte schlichtweg ein Altar, an dem man nach heutigem Verständnis Eucharistie feiern konnte. Deshalb verlief die Gabenbereitung ein wenig anders als gewohnt. Denn es wurden nicht nur die Gaben von Brot und Wein herbeigebracht, sondern vorweg fiel mir zusammen mit einem anderen Eingeladenen die außergewöhnliche Aufgabe zu, einen nicht gerade leichten Altar in die Kirche hineinzutragen, damit die eucharistischen Gaben und der vorstehende Priester im Fortgang der Feier überhaupt einen Platz hatten. So hilft nicht zuletzt gelebte Liturgie, Freundschaften zu bauen und zu erhalten.
Doch kommen wir nun zur Liturgiewissenschaft im eigentlichen Sinn. In der Dissertation hat sich Birgit Jeggle-Merz mit einer Gestalt der Liturgischen Bewegung befasst, die ein besonderes Lebensschicksal hatte: mit dem Laacher Mönch Athanasius Wintersig, der später die Abtei verließ, dabei seinen Namen zu Ludwig Anton Winterswyl änderte und schließlich tragisch auf einem Vorortbahnhof von Freiburg ums Leben kam. Wintersig hatte 1924 als erster ein Wissenschaftskonzept für die Pastoralliturgie entworfen. Anknüpfend an diese Studie möchte ich zwei Aspekte hervorheben, die für Birgit Jeggle-Merz bleibend charakteristisch sind: Sie interessiert sich nicht nur für wissenschaftliche Fragestellungen an sich, sondern auch für die Menschen, die diese Wissenschaft betreiben und auf die hin Wissenschaft betrieben wird. Das ist ein hohes Ethos, ein Selbstverständnis, von dem in der Lehre ihre Studierenden und bei ihren vielen Vorträgen die Zuhörer profitieren. Theologische Wissenschaft und menschliche Zugewandtheit reichen sich bei Birgit die Hand.
Der andere Aspekt ist thematischer Art: Die Pastoralliturgie, also vor allem die kritische Reflexion der liturgischen Feierpraxis, ist über die Jahrzehnte hinweg einer von Birgits Schwerpunkten geblieben, und das immer mit einem weiten Horizont, vor dem sie aufkommende Fragen und Probleme erfasst, aber sie auch konstruktiven Lösungen entgegenführt. Hier in der Theologischen Hochschule Chur hat sie diese Kompetenz unter anderem in das Pastoralinstitut eingebracht.
Das Verhältnis von „Liturgie und Bibel“ hat einen bedeutenden Teil von Birgits Arbeit eingenommen. Sie hat nicht nur als Redaktionsmitglied der Zeitschrift „Bibel und Liturgie“ gut zwei Jahrzehnte auf diesem Feld gearbeitet; vielmehr ist der mehrbändige, methodisch innovative „Luzerner biblisch-liturgische Kommentar zum Ordo Missae“, den sie mit Walter Kirchschläger und Jörg Müller herausgegeben hat, ein eindrückliches Zeugnis davon. Ihre jahrelange Tätigkeit als Zentralpräsidentin des Schweizerischen Katholischen Bibelwerks (2011–2019) gehört genauso zu diesem Schwerpunkt.
Nicht zuletzt durch den schweizerischen kirchlichen Kontext veranlasst hat Birgit Jeggle-Merz sich intensiv mit der Wort-Gottes-Feier als einer derzeit weithin begegnenden Gottesdienstform befasst, nach ihrer theologischen Begründung gefragt und die Wertschätzung des Wortes Gottes in der Liturgie einschließlich eines angemessenen symbolischen Ausdrucks betont. Weiter zurück, und zwar in die Freiburger Assistentenzeit bei Helmut Büsse, reicht das Interesse an medial vermittelten Gottesdiensten, zunächst im Fernsehen, inzwischen auch mit Hilfe des Internets und anderer Kommunikationsmittel mit all den daraus entstehenden Fragen, was etwa Teilnahme als ein Schlüsselbegriff heutigen Liturgieverständnisses in dem Rahmen bedeutet. Eine Reihe von Arbeiten widmet sich der Liturgiewissenschaft als theologischer Disziplin, die mehr als andere Fächer der Theologie mit Erfahrung verknüpft ist, ihrem Selbstverständnis, ihren Aufgaben und Entwicklungen, immer mit einer großen Sensibilität für neue Herausforderungen im Leben der Kirche und im Gottesdienst. Arbeiten zu liturgischen Diensten finden sich darunter ebenso wie Untersuchungen zum Kirchenraum angesichts der kirchlichen und gesellschaftlichen Umwälzungen der Gegenwart oder zur Theologie und Spiritualität der Liturgie. Schon seit vielen Jahren ist Birgit Jeggle-Merz wieder die einzige Frau auf einem Lehrstuhl für Liturgiewissenschaft im deutschen Sprachgebiet; das hat es fast zwangsläufig mit sich gebracht, dass sie um Positionierungen zur Rolle der Frau in der Liturgie gebeten wurde, was sie mit nüchterner Klarheit, aber ohne Ideologie getan hat. Wenn man, soweit das in dieser Kürze möglich ist, einen Gesamtblick versucht, zeichnet sich das theologische Schaffen von Birgit Jeggle-Merz durch seine Kontextualität aus; Theologie wird nicht im abstrakten Raum betrieben, sondern im Blick auf die vielfältigen Realitäten (im Plural), mit denen sie konfrontiert ist und in die hinein die Botschaft Jesu Christi unter den Menschen vermittelt werden soll.
Es war und ist für Birgit selbstverständlich, kirchliche Mandate anzunehmen. Ich nenne nur einige wichtigere davon: im Auftrag der Schweizer Bischofskonferenz die Mitarbeit in der „Konferenz Liturgie der Kirche im deutschen Sprachgebiet (KLD)“ genauso wie in der Liturgischen Kommission und im „Kuratorium des Liturgischen Instituts der deutschsprachigen Schweiz in Freiburg“. Bei der in Vorbereitung befindlichen Neuausgabe des schweizerischen katholischen Gesangbuchs „Jubilate“ gehört sie zum Projektteam; bei der im letzten Jahr aufgegleisten Kommission für die Revision des deutschsprachigen Messbuchs leitet sie eine der vier Arbeitsgruppen. In der „Arbeitsgemeinschaft katholischer Liturgiewissenschaftlerinnen und Liturgiewissenschaftler im deutschen Sprachgebiet (AKL)“ hat sie sich über mehrere Jahrzehnte hinweg engagiert, den Kongress 2012 über „Liturgie und Konfession“ hier in Chur ausgerichtet, seit einigen Jahren die Moderation der Sektion Schweiz übernommen und in der Leitung des „Netzwerkes Liturgiewissenschaftlerinnen“ mitgewirkt.
Beim „Archiv für Liturgiewissenschaft“ ist sie seit 1995 Ständige Mitarbeiterin, nach dessen Neustrukturierung seit 2023 Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats. Für die hier in Chur herausgegebene Online-Zeitschrift „transformatio;“ ist sie seit 2019 Redaktionsmitglied ebenso wie bei der in Wien erscheinenden Online-Zeitschrift „Ex fonte“, außerdem zählt sie zum Wissenschaftlichen Beirat der „Pius-Parsch-Studien“ (Klosterneuburg).
Es ließen sich viele weitere Themen und Anlässe nennen, zu denen Du, Birgit, Wesentliches beigetragen hast und beiträgst. Deine Familie hat Dich dabei unterstützt. Ich habe mich gefreut und freue mich weiterhin, dass wir die vor 40 Jahren nicht absehbare Gelegenheit bekommen haben, hier in der Schweiz an den Schlüsselstellen der Theologie die Liturgiewissenschaft zu vertreten, manches Gemeinsame auf den Weg zu bringen von Doktorandenkolloquien und der AKL Schweiz über einzelne Publikationen bis hin zu den vielen Arbeiten im Raum der Kirche. Im Namen unseres Faches danke ich Dir für Deinen großen und uneigennützigen Einsatz. Ich wünsche Dir von Herzen weiter eine in jeder Hinsicht gute Zeit, Mitmenschen, die Dich in der Familie, in Freundschaften und im Kollegenkreis auch auf Zukunft hin tragen, gute Gesundheit, Freude bei der sicher nicht völlig abreißenden Arbeit, die aus innerer Überzeugung wächst – und in Bälde auch ein wenig mehr Ruhe und Entspannung, als Du sie im Intercity zwischen Chur und Luzern und so vielen anderen Orten in den letzten Jahren genießen konntest. Ad multos annos!
Prof. em. Dr. Martin Klöckener
Forschungsexkursion des Promotionskollegs: Mailand 2025
«Auf den Spuren des heiligen Ambrosius»
Die Geschichte des Bistums Chur reicht vermutlich bis in das 4. Jahrhundert zurück, womit es den ältesten Bischofssitz der Schweiz darstellt. Dabei wird angenommen, dass die damalige Gründung des Bistums, von der im 4.Jh. zum Erzbistum erhobenen Diözese Mailand ausgeht. Dadurch sind auch noch heute mailändische Bezüge im rätischen Gebiet zu erkennen. Das Erzbistum selbst ist wiederum vom Erzbischof und gleichzeitigen Patron dem hl. Ambrosius geprägt, dessen Leichnam in der Kirche Sant´Ambrogio zur Ruhe gebettet ist. Sein Wirken ist bis heute in der Mailänder Bistumsgeschichte sowie in der ortsansässigen Liturgie spürbar.
Aus diesem Grund organisierte die Theologische Hochschule Chur vom 11.05. bis zum 15.05. eine Forschungsexkursion für Mitglieder des Promotionskollegs nach Mailand, um auf den Spuren des heiligen Ambrosius seine Auswirkungen auf das heutige Erzbistum Mailand und dem Bistum Chur zu untersuchen. Die Exkursion zeigte dabei zwei Schwerpunkte im Bereich der praktischen Theologie auf: Zum einen wurde der ambrosianische Ritus analysiert und mit dem römischen Ritus verglichen. Ziel war es, dies konkret im Zusammenspiel von Liturgie und Kirchenraum zu ermöglichen. In diesem Kontext wurden verschiedene Kirchen in Mailand aufgesucht und ein Gottesdienst im ambrosianischen Ritus mitgefeiert, um ein Gespür dafür zu bekommen, wie Raum und liturgische Feier aufeinander einwirken. Zum anderen wurden im Rahmen der Pastoraltheologie Gespräche mit Verantwortlichen der Theologischen Fakultät in Sacro Cuore sowie dem Dominikanerkloster Santa Maria della Grazie geführt. Hierbei ging es darum zu erkennen, welche pastoralen Herausforderungen der Theologie und Seelsorge in Mailand begegnen und welche Pastoralkonzepte dafür umgesetzt und entwickelt werden. Verantwortlich für die Exkursion sowie deren Organisation und Umsetzung waren Prof. Franziskus Knoll, Prof Birgit Jeggle-Merz sowie deren Assistenz Fabio Theus.
Die Reise begann am Sonntag, dem 11. Mai. 2025 und erfolgte per Flixbus nach Mailand, wo wir als Gruppe von sieben Personen am Nachmittag unsere Unterkunft in Bicocca bezogen und den ersten Abend natürlich bei optimaler italienischer Verpflegung ausklingen liessen.
Der Montag stand ganz im Zeichen der Liturgiewissenschaft, weshalb die Forschungsreise mit einem Besuch der Mailänder Kathedrale und dem Dommuseum startete. Nebst der Besichtigung des Domdaches wurde auch der Kirchenraum von innen her analysiert. Nach den ersten Eindrücken und Feststellungen bezüglich der Raumverteilung und Architektur des Mailänder Doms stand schliesslich eine Eucharistiefeier im ambrosianischen Ritus auf dem Programm. Im Anschluss daran bot sich die Möglichkeit, einen Vergleich zum römischen Ritus zu ziehen und dabei zu
überlegen, welche theologischen Aussagen mit liturgischen Handlungen getroffen werden. Dabei ging es nicht nur um die Frage, wie der Ritus sich im konkreten Vollzug eines Gottesdienstes darstellt und wie der Raum auf die Liturgie wirkt, sondern auch, wie die Musik das Moment des Feierns beeinflussen kann. Diesbezüglich hatten wir am Abend also die einzigartige Möglichkeit eine private Probe der Mailänder Dom Scola live und a capella mitzuerleben. In diesem Sinne lässt sich sagen, dass Liturgie mit allen Sinnen erlebt werden konnte.
Am Dienstag wurde am Morgen eine Führung an der Mailänder Scala organisiert, was einen Einblick in die Kunst- und Theatergeschichte der Stadt ermöglichte. Am Nachmittag besuchten wir schliesslich die Theologische Fakultät an der katholischen Universität Sacro Cuore sowie das Grab des hl. Ambrosius in Sant´Ambrogio. Neben einem spannenden Einblick in die Forschungsbereiche der biblischen Wissenschaften sowie Einblicke in Manuskriptteile aus den Evangelien, wurden uns Texte vorgestellt, die bis aus der Zeit des babylonischen Grossreiches stammen. Nach dieser eindrücklichen Erläuterung jener historischen Quellen, kam es zu einem Gespräch mit dem Centro Pastorale di Milano und P. Enzo Viscardi, der uns etliche Räumlichkeiten der Universität erläuterte. Weiterhin fand ein Austausch über das Verhältnis von Staat und Theologie in Italien statt. Dabei ging es vor allem um die Rolle des Pastoralzentrums innerhalb der katholischen Universität sowie die Art und Weise, wie die Universität als staatliche Institution mit Theologie als Wissenschaft umgeht. Vor dem Hintergrund, dass in Italien keine staatlichen theologischen Fakultäten existieren, ergab sich daraus ein spannender Diskurs darüber, wie Theologie in Zukunft neben anderen Wissenschaften in den Universitäten praktiziert werden kann. Ein überraschender Besuch erfolgte schliesslich noch von Bischof Mons. Claudio Giuliodori, Generalkaplan der Katholischen Universität Sacro Cuore, der sich für unsere kleine Gruppe extra Zeit nahm, um seine Sicht über die Herausforderungen des Centro Pastorale und der Theologie zu schildern und sich mit uns in einen Austausch darüber zu begeben. Dabei ging er vor allem auf die Frage ein, wie Theologie im Zusammenhang mit Human- und Naturwissenschaften einen Beitrag leisten kann. Spannend war die Erkenntnis, dass an der Universität oftmals Dissertationen mit theologischem Thema einen starken interdisziplinären Charakter haben, da das Fach Theologie nur im Kontext von anderen Fachrichtungen gelehrt wird und dadurch nicht isoliert betrachtet wird. Hierbei wurden einige Anregungen aufgestellt, wie theologische Forschungsprojekte auch in der Schweiz interdisziplinär bearbeitet und gefördert werden könnten.
Am letzten Tag der Exkursion besuchten wir am Morgen das Castello Sforzesco und dem dort hiesigen Museum über die Geschichte des Schlosses. Anschliessend empfingen uns die Dominikaner des Klosters Santa Maria della Grazie. Der dortige Prior ermöglichte uns eine Führung innerhalb des Klosters und gab uns einen Einblick in die Situation der Gemeinschaft und der Stadtseelsorge innerhalb von Mailand. Hierbei ging es vor allem darum zu verstehen, welche seelsorglichen Angebote die Menschen konkret suchen und wie die Seelsorgenden den Anliegen der Menschen gerecht werden können. Der Zeitpunkt
wurde genutzt, um verschiedene Pastoralkonzepte ausgiebig zu diskutieren und zu hinterfragen. Dies geschah vor allem mit Hinblick auf die unterschiedlichen Situationen der Schweizer Bistümer sowie des Erzbistums Mailand. Im Hintergrund stehen je nach Bistum- und Landesgrenze unterschiedliche Priesterzahlen sowie ein differenzierter Umgang mit Laienseelsorgenden und verschiedenen Gottesdienstformen. Obwohl zwischen Chur und Mailand nur ca. 150 km Luftlinie liegen, sind die pastoralen Anliegen und Konzepte doch recht verschieden. Der letzte Abend wurde dann noch einmal im Mailänder Flair genossen, bevor es dann am Donnerstag wieder zurück in die Schweiz ging.
Alles in allem war es eine sehr gelungene Exkursion mit vielen Eindrücken, lehrreichen Begegnungen und einer angenehmen Gruppe aus den Mitgliedern des Professoren- und Promotionskollegs der Theologischen Hochschule Chur. Wir bedanken uns bei allen Personen, die uns an dieser Exkursion einen Einblick in die Liturgie und die pastorale Situation des Erzbistums ermöglicht haben: Den Mitgliedern der Mailänder Dom Scola; P. Enzo Viscardi und Mons. Claudio Giuliodori der Universität Sacro Cuore sowie dem Prior der Dominikaner Santa Maria della Grazie Robert Gay für ihre Bereitschaft und Gastfreundschaft. Ebenso danken wir Prof. Franziskus Knoll, Prof. Birgit Jeggle-Merz sowie Fabio Theus für die Organisation und den reibungslosen Ablauf. Ein spezielles „Grazie“ soll an dieser Stelle auch noch an Fabio Theus und an Daniel Bachmann erfolgen, die an diesen Tagen oftmals die Rolle der Dolmetscher übernommen haben!
Niklas Reypka
Wissenschaftscafé: Zwischen Gewalt und Diplomatie: Wege zum Frieden im Nahen Osten
Unter dem Titel «Zwischen Gewalt und Diplomatie: Wege zum Frieden im Nahen Osten» lud die TH Chur zu einer mit anerkannten Fachleuten besetzten Diskussionsrunde ein. Alfred Bodenheimer (Universität Basel) beleuchtete die aktuellen Entwicklungen aus religionshistorischer und judaistischer Perspektive, Siegfried Weichlein (Universität Fribourg) ordnete den Konflikt zeithistorisch ein, und Markus Lau (TH Chur) brachte bibelwissenschaftliche Impulse sowie seine Kenntnis Israels und Palästinas ein. Moderiert von Christian Cebulj eröffnete die Diskussion neue Blickwinkel und regte zum Weiterdenken über mögliche Wege zum Frieden an.
Medienspiegel:
Poetry Slam und Theologie: Eine Einführung
Im Studienjahr 2024/2025 wurde im Rahmen des Campus-Angebots der Theologischen Hochschule Chur in Kooperation mit dem Priesterseminar St. Luzi ein Workshop unter dem Titel «Poetry Slam und Theologie: Eine Einführung» durchgeführt. Das Angebot verband die kreative Auseinandersetzung mit theologischen Themen mit der Kunstform des Poetry Slams – einer lebendigen und populären Form der Bühnenpoesie.
Beim Poetry Slam tragen Dichter:innen selbst geschriebene Texte auf einer Bühne vor. Der Kreativität von Text und Performance sind dabei kaum Grenzen gesetzt: Es kann um persönliche Erlebnisse gehen, um die Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Fragen, um religiöse oder politische Themen. Doch ein guter Text allein reicht nicht aus: Mit rhetorischem Geschick gilt es, diesen mit Emotionen und Rhythmus vorzutragen. Unter der Leitung der erfahrenen Slam-Poetin Piera Cadruvi lernten die teilnehmenden Studierenden, eigene Texte zu verfassen und diese vor Publikum wirkungsvoll vorzutragen.
Der Workshop gliederte sich in drei Teile. Im ersten Teil ging es um das Schreiben von Texten: Mit kreativen Methoden sollte die Angst vor dem leeren Blatt genommen werden. Übungen zur Ideenfindung, zum spielerischen Umgang mit Sprache und zum Aufbau von Texten halfen dabei, erste Schreibversuche zu machen. Ziel war es, ins Schreiben zu kommen und sich mit unterschiedlichen Stilen und Themen auszuprobieren.
Im zweiten Teil stand das Vortragen der Texte im Mittelpunkt. Gemeinsam wurde an Ausdruck, Stimme, Haltung und Präsenz gearbeitet. Dazu gehört auch, sich auf die unterschiedlichen «Bühnenrealitäten» einzulassen: Wie spricht man in ein Mikrofon? Wie liest man einen Text in einer Kirche? Wohin mit den Händen, wenn man sich an nichts festhalten kann? Piera Cadruvi schuf eine offene, unterstützende und ermutigende Übungsatmosphäre.
Den Abschluss bildete der Theo-Slam, zu dem Lehrende, Studierende und Interessierte eingeladen waren. In gemütlicher Wohnzimmeratmosphäre wurden die selbst verfassten Texte präsentiert. Anders als bei klassischen Poetry Slams ging es nicht um einen Wettbewerb, sondern um den mutigen Versuch vor einem motivierten Publikum Texte zu präsentieren. Die Vielfalt der Beiträge war beeindruckend: humorvoll, ernst, poetisch und tiefgründig.
Die Themen reichten vom Nachdenken über Fernweh bei Kaffee Baileys, über die Schwierigkeiten, unter Zeitdruck einen Text schreiben zu müssen, bis hin zur Faszination für ein (nicht) vorhandenes Kunstwerk. Es ging um Marienlieder, um den idealen Zigarettenstummel und um Einträge aus einem Tagebuch, das im Brockenhaus gefunden wurde. Die Slammer:innen präsentierten ihre Texte mit viel Engagement und spürbarer Freude an Sprache und Performance. Piera Cadruvi moderierte den Anlass lebendig und feinfühlig und gab auch selbst einen ihrer Texte zum Besten.
Der Workshop Poetry Slam und Theologie eröffnete neue Zugänge zum theologischen Denken und Schreiben. Er zeigte, wie Theologie lebendig werden kann – nicht nur im akademischen Diskurs, sondern auch im kreativen Ausdruck, im Erzählen und Sprechen. Das Organisationsteam bedankt sich herzlich bei den «Freunden und Freundinnen der TH Chur», die mit ihrer finanziellen Unterstützung dieses Angebot erst möglich gemacht haben.
René Schaberger
Treffen des Arbeitskreises der katholischen Exegetinnen und Exegeten der Schweiz an der TH Chur
Zorn, Liebe und Ekel standen als Affekte und Emotionen im thematischen Zentrum des diesjährigen Treffens des Kreises der kath. Exegetinnen und Exegeten der deutschsprachigen Schweiz, das in diesem Jahr an der TH Chur stattfand. «Emotionen in biblischen Texten» war dabei das Oberthema, das nicht nur Fachleute für die biblische Exegese aus den Bereichen Erwachsenenbildung, Bibelpastoral und universitärer Exegese nach Chur führte, sondern erfreulicherweise auch stets eine Gruppe von Studierenden der TH Chur zu den Vorträgen lockte, so dass an die zwanzig Personen am Treffen teilnahmen.
Prof.in Dr. Sigrid Eder (Freiburg) referierte dabei in ihrem Eröffnungsvortrag, der zugleich methodische Wege der exegetischen Analyse von erzählten Emotionen und Emotionalisierungsstrategien aufzeigte, zu «Emotionen im Gottesbild der hebräischen Bibel – am Beispiel der Psalmen». Sie zeigte dabei insb. auf, welche Funktion der Zorn JHWHs im Rahmen der narrativen Strategien der Texte hat und hob dabei im Besonderen auf den Zusammenhang von Zorn und Gerechtigkeit Gottes ab. Prof. Dr. Michael Fieger (Chur) ging unter dem Titel «Die Liebesbeziehung zwischen Jonathan und David aus der Sicht der Vulgata» auf die Präsenz von Emotionen in der Beziehung zwischen Jonathan und David ein und zeigte auf, wie die emotionale Beziehung zwischen beiden Erzählfiguren im hebräischen, griechischen und vor allem lateinischen Text (Vulgata) und damit im Prozess der Übersetzung gestaltet wird. Prof. Dr. Markus Lau (Chur) stellte in seinem Vortrag «Ekelhaft. Exegetische Beobachtungen zur Konstruktion eines starken Affekts in neutestamentlichen Texten» Fallbeispiele für die erzählerische Inszenierung von Ekel im Rahmen griechisch-römischer Kultur vor und zeigte an einigen Beispielen, wie in ntl. Texten dieser Affekt in Anknüpfung und Durchbrechung kultureller Plausibilitäten der Antike inszeniert wird.
Neben den Vorträgen und den anschliessenden intensiven Diskussionen bot das Treffen Gelegenheit zum Austausch über anstehende inhaltliche Projekte und zur Vernetzung zwischen den unterschiedlichen Arbeitsfeldern der Teilnehmer:innen. Eine auf die Archäologie und Baugeschichte der St. Luzikirche abzielende Führung im Kerzenschein mündete in einem musikalischen Abendausklang: Magdalena Widmer und Patrick Gröhl brachten die Orgel der St. Luzikirche zum Klingen. Für optimale Rahmenbedingungen sorgte zudem das Hausteam von Priesterseminar und Hochschule. Allen Beteiligten gilt der herzliche Dank des gesamten Arbeitskreises.
Die Organisation der Tagung lag in den Händen von Sr. M. Manuela Gaechter OP, Studienleiterin an der TH Chur und Doktorandin im Alten Testament an der Uni Luzern, und Markus Lau, Neutestamentler an der TH Chur. Beide sind auch für die Koordination des gesamten Arbeitskreises verantwortlich.
Markus Lau